
LUPA ROMANA

|
Start | Projekte | Publikationen | Lupa-Blog | Geschichtliches | Über mich |

|
Rezension Andrea Schütze: Stefan Pfeiffer, Die Flavier
Wissenschaftliche Rezension
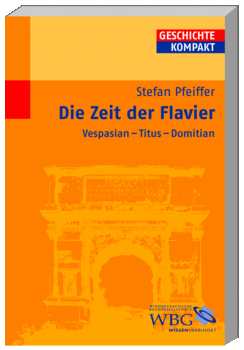 |
Werkdaten: Stefan Pfeiffer: Die Zeit der Flavier, WBG Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 2009 ISBN-10: 9783534208944 134S., Preis: 14,90 €. |
Weitere Erscheinungsorte
der Rezension:
|
|
Verglichen
mit dem in zeitloser Schönheit erstarrten Augustus, den
skandalumwitterten Mitgliedern des julisch-claudischen Kaiserhauses und
dem oft verklärten Zeitalter kultureller Blüte der Adoptivkaiser
fristeten die derb wirkenden, vierschrötigen Kaisergestalten der
Flavier mit dem schon fast schockierenden Realismus eines Vespasian in
der Forschung lange Zeit ein wenig attraktiv wirkendes Dasein. Die
aktuelle Forschung, die sich mit neuen Fragen Gewalt, Krieg und Medien
zuwendet, hat dieses Bild verändert. Dennoch fehlte bislang eine knappe
und kompakte Einführung in diese Epoche, die den Interessierten
fundiert mit den entscheidenden Streitständen und Problempunkten
vertraut macht. Diese Lücke füllt nun Pfeiffers „Die Zeit der Flavier“
aus der Reihe „Geschichte kompakt“, deren Herausgeber sich zum Ziel
setzen, „auf dem Kenntnisstand der heutigen Forschung“ Interessierten
eine fundierte Einstiegsgrundlage zu bieten und „komplexe und
komplizierte Inhalte konzentriert, übersichtlich und gut lesbar
darzustellen“ (S. VII). Der Band zeichnet sich durch einen dreiteiligen
Aufbau aus: Drei Abschnitte (Vorbemerkungen, Quellenübersicht,
Vierkaiserjahr) führen zum Hauptteil, der Darstellung der Regierungen
der drei flavischen Herrscher Vespasian, Titus und Domitian hin,
während wiederum drei Abschnitte (Provinzen, Religiöse Entwicklungen,
Bilanz einer Epoche) einen vertiefenden Ausklang bieten. Eine
Auswahlbibliographie und ein Register vervollständigen das Werk.
Zeittafeln, Exkurse und Quellenbelege lockern auf und schaffen einen
zeitlichen Rahmen. Die sprachliche Gestaltung ist klar, leicht
verständlich und gut lesbar. Gleich zu Beginn stellt Pfeiffer dem Leser die wichtigsten Quellen zur Flavierzeit vor, wobei Tacitus und Sueton am ausführlichsten besprochen werden. Dabei versteht er es, Sueton vom Stigma des „Klatschreporters“ (S. 2) freizusprechen, bleibt meines Erachtens jedoch in der Bewertung zu wenig quellenkritisch. Gerade da die Quellen aus späterer Zeit das Gros unserer Belege für die Flavier darstellen, ihre Autoren also nicht mit zeitgenössisch-flavischer Perspektive schrieben, sondern unter anderen Vorzeichen (Ermordung Domitians oder damnatio memoriae) ihre Wertungen vornahmen, sollten deren Tendenzen klarer herausgearbeitet werden. Pfeiffer stellt dies im Falle des Tacitus zwar grundsätzlich richtig dar (S. 1). Etwas irreführend erscheint mir hingegen Pfeiffers Formulierung: „beide stimmen aber in ihrer Grundhaltung zu den jeweiligen Kaisern überein“ (S. 2). Die inhaltlich zwar richtig festgestellt Kongruenz zwischen Tacitus und Sueton könnte aber ohne weitere Erläuterung dem anvisierten Leserkreis zur fehlerhaften Schlussfolgerung verleiten, ihnen gerade aufgrund dieser Feststellung eine gesteigerte Glaubwürdigkeit (speziell im Fall des letzten Flaviers) beizumessen. Weiter hätte für Tacitus in diesem Zusammenhang nicht allein auf „seine senatorisch-republikanisch aufrechte Gesinnung“ (S. 1) hingewiesen, sondern auch die Problematik um den Schwiegervater Agricola angesprochen werden müssen, dessen Schicksal mitbegründend für seine Haltung war. Gleiches gilt für die Wendehalsmentalität des jüngeren Plinius, auch sie hätte thematisiert werden können; Martial und Statius zusammen in nur einem Satz zu würdigen, dürfte auch im Rahmen einer Einführung eindeutig zu kurz greifen. Pfeiffer eröffnet an dieser Stelle auch einen Blickwinkel über den althistorischen Tellerrand hinaus auf die wichtigen archäologischen Quellengattungen; mit erfreulicher interdisziplinärer Offenheit betont der Verfasser, dass es „Aufgabe der Althistoriker ist […], die Erkenntnis der archäologischen Forschung mit in die Interpretation der flavischen Geschichte einzubeziehen“ (S. 2). Die Darstellung des Vierkaiserjahres, eine aufgrund teils paralleler, teils gegenläufiger Handlungsstränge gerade für den Einsteiger schwierige Materie, ist Pfeiffer durchaus gelungen, auch wenn Neros Tod zunächst etwas im Raume stehen bleibt. Hervorragend beleuchtet Pfeiffer den mit Neros Tod einhergehenden Politikwechsel, das Agieren des an Bedeutung verlierenden Senats und die zunehmend offene Machtakkumulation des Militärs, das nunmehr als Mittel der Kaiser zur Herrschaftslegitimation und -stablilisierung diente. Dies gilt insbesondere für die in diesem Ringen als Sieger hervorgegangenen Flavier, die nicht mit Ahnen, sondern militärischer virtus punkten konnten – ursprünglich ein Ideal der republikanischen Elite. Pfeiffers präziser Blick für die inneren Zusammenhänge fällt in der Darstellung an zahlreichen Stellen auf, so auch in der Beschreibung der flavischen Herrscher. In seinem Vespasian-Kapitel spielen daher weniger biographische, als politische Aspekte eine Rolle, der manche bereits zum Wissenskanon aufgestiegene Anekdote um Vespasian zum Opfer fiel. Überaus positiv ist es aus dieser Perspektive zu bewerten, dass dem Einsteiger von Anfang an die strategische Politik Vespasians nahe gebracht wird, die zunächst als eine traditionelle Fortsetzung der julisch-claudischen erscheint, realiter aber – wie Pfeiffer überzeugend herausarbeitet – sich jedoch als eine eigene, weit darüber hinausgehende entpuppt. Die die flavische Zeit kennzeichnenden (verhaltenen oder offenen) Konfrontationen des Kaisers mit dem Senat und anhängenden Philosophenkreisen werden als Konflikt zwischen flavischem Dynastiewillen und senatorischer Vorstellung vom Adoptivkaisertum verständlich. Gelungen stellt Pfeiffer die reiche Palette politischer Variationen vor, deren sich Vespasian machtbewusst bediente; so analysiert er beispielsweise das Bestallungsgesetz Vespasians, das ihm eine klar geregelte Rechtsgrundlage verschaffte, die schon sprichwörtlich gewordene Finanzpolitik Vespasians (pecunia non olet) oder die ideologisch hoch aufgeladene und fein durchdachte Baupolitik im Dienste der neuen Dynastie. Für Titus stehen zunächst einzelne historische Ereignisse wie Flaviertriumph, Vesuv-Ausbruch, Brand Roms oder das Seuchenproblem im Vordergrund. Dennoch lenkt Pfeiffer auch hier den Blick tiefer, etwa auf den schlagartigen Wandel des Titus vom „bösen Prinzen“ hin zum Ideal des „guten Kaisers“. Auch für Titus gilt das politische Traditionsprinzip unter gleichzeitigem Beschreiten eigener Wege bis hin zur Verdrängung des eigenen Vaters, was sich etwa am Titusbogen zeigt. Der dritte Flavier Domitian wird teils exzellent, teils weniger gelungen erörtert: Hervorragend und damit gewissermaßen auch das „Filetstück“ dieser Kaiservita ist Pfeiffers Darstellung von Domitians programmatischer – und hinter der des Vaters wohl nicht zurückstehender – Baupolitik (auch wenn nicht alle Ausführungen zu den Cancelleria-Reliefs korrekt sind).[1] Überzeugend ist auch die Analyse des Spannungsverhältnisses zwischen Domitian und der römischen Elite anhand „drei antidomitianische[r] Kreise“ (S. 73). Schön herausgearbeitet sind zudem die weiteren Schwerpunkte in der Herrschaftspraxis Domitians, so die (verfehlte) Sittenpolitik des Kaisers, die unklare Differenz zu Vater und Bruder oder auch der Einstieg Domitians in die Geschichte während des Kapitol-Brandes 69 v.Chr. Bedauerlich bleibt, dass Pfeiffer im Zusammenhang mit letzterem Ereignis nicht seine enorme propagandistische Bedeutung im Rahmen der kaiserlichen Selbstdarstellung betont, die den Kaiser sogar zu einem selbst verfassten Epos veranlasste. In diesem Kapitel fehlen fast vollständig die Rekurse auf Domitians militärische Einsätze in Germanien und Dakien. Pfeiffer handelt dies zwar im anschließenden Abschnitt über die „Provinzen“ ab, doch geht meines Erachtens dadurch viel für die Gestalt Domitians verloren. Eine derartige Auslagerung erweist sich im Fall von Vespasian und Titus als nicht weiter problematisch, da deren Regierungen deutlich militärisch geprägt sind und im entsprechenden Abschnitt jeweils auch ausreichend auf diese Konflikte hingedeutet wird, ohne eine Schieflage zu erzeugen. Im Falle Domitians ist dies jedoch nicht in gleicher Weise gelungen: So geht etwa ein wesentliches (auch von den Quellen angesprochenes) Argument für das brüderliche Spannungsverhältnis und das herrscherliche Akzeptanzproblem Domitians verloren, mit dem dieser sich konfrontiert sah. Im Vergleich zu seinen Vorgängern und Nachfolgern entwirft Pfeiffer damit ein zu ziviles Bild Domitians, das gerade auf der Darstellung der nicht unproblematischen nachdomitianischen Quellen beruht und bei genauerer Betrachtung wohl nicht zu halten ist. Für die Auslagerung der Kapitel „Provinzen“ und „Religiöse Entwicklungen“ sprechen sicherlich gute Argumente, doch erscheint mir dieser Nachtrag gerade im Hinblick auf den Darstellungsfluss als etwas störend. Auch in drei weiteren Punkten kann Kritik nicht verschwiegen werden: Pfeiffer bietet dem Leser viele sehr gute Exkurse; die damnatio memoriae wird hingegen von ihm eindeutig zu oberflächlich und zu kurz betrachtet. Problematisch ist zudem, dass zahlreiche Literaturhinweise im Text (lediglich Autorennachname und Jahreszahl werden genannt) im Literaturverzeichnis nicht aufgeführt werden – ein Mangel, der den Einstieg erschwert.[2] In einer solchen Einführung muss sich der Autor im Literaturverzeichnis zweifellos auf ein Auswahl beschränken, allerdings sollte beispielsweise Barbara Levicks Vespasian-Biographie nicht fehlen.[3] Möglicherweise hätte man sich an dem einen oder anderen Punkt eine gründlichere Darstellung gewünscht, doch sind Rahmen und Zielsetzung der Reihe als Bewertungsmaßstab anzulegen. Im Rahmen dieses einführenden Werkes musste der Autor Abstriche zugunsten von Klarheit und Übersichtlichkeit machen. Die von den Herausgebern eingangs erwähnte Zielsetzung darf aber ganz klar als erfüllt betrachtet werden, bietet Pfeiffers Einführung doch einen sehr guten Einstieg für Neulinge in der Thematik; sie weiß aber auch dem Erfahreneren durchaus noch Neues zu vermitteln und regt zur Auseinandersetzung und Diskussion an. Der Autor vermag dabei auch komplexe Zusammenhänge leicht fasslich darzustellen. Ein Buch dieser Qualität kann die Rezensentin daher als Einstiegslektüre für die flavische Zeit jedem Interessierten nur wärmstens empfehlen. Andrea Schütze Andrea Schütze München, Andrea Schuetze, Lupa Romana, Historikerin, Rechtshistorikerin, Althistorikerin, Mediävistin, Kunsthistorikerin, Rechtshistorikerin, Archäologin, Rezension. |
|